– gegengelesen –
Ivan Krastev: Europadämmerung (Teil 3)

Ivan Krastevs Blick geht über die EU hinaus. Nicht nur innerhalb ihrer Grenzen, sondern auch außerhalb setzt sie seiner Ansicht nach auf eine Entwicklung hin zu mehr Demokratie und Toleranz. Zweifelsohne würde man aus europäischer Sicht demokratische Tendenzen weltweit begrüßen. Allerdings bildete sie von Beginn an vor allem ein bewusstes Gegengewicht zu den undemokratischen Systemen, wie sie damals auch in Europa noch zahlreich waren. Wenn schon versteht sich die EU nicht als Wette auf eine demokratische Zukunft, sondern als Bollwerk gegen Diktaturen.
Krastevs Kritik am naiven Idealismus richtet sich aber offenbar ohnehin weniger gegen die EU allein, sondern gegen den Liberalismus insgesamt. Er bemängelt, dass dieser die Verwirklichung seiner Prinzipien stets nur auf nationaler Ebene angestrebt und die Problematik globaler Realisierbarkeit ausgeblendet habe:
„Der Widerspruch zwischen dem universellen Charakter der Menschenrechte und ihrer Ausübung im nationalen Kontext bildet den Kern der aktuellen Krise der Linken angesichts des Flüchtlingsstroms.“ (S. 41)
„Entweder die Menschen genießen absolute Freiheit bei der Suche nach Arbeitsplätzen und einem höheren Lebensstandard, oder die gewaltigen wirtschaftlichen und politischen Unterschiede zwischen den Staaten verschwinden, so dass die Menschen ihre universellen Rechte überall in gleicher Weise genießen können. Keins von beidem wird so bald geschehen – wenn denn überhaupt jemals. […] Heute gibt es in der Welt zahlreiche scheiternde oder gescheiterte Staaten, in denen niemand leben und arbeiten möchte, und Europa ist weder in der Lage noch bereit, offene Grenzen zuzulassen.
Die Migrationskrise konfrontiert den Liberalismus mit einem für seine Philosophie zentralen Widerspruch. Wie lassen sich unsere universellen Rechte mit der Tatsache vereinbaren, dass wir sie als Bürger ungleich freier und wohlhabender Gesellschaften genießen?“ (S. 36f)
Krastev stellt einen Zusammenhang zwischen dem universalistischen Liberalismus und Migrationsbewegungen her. Es klingt, als hätten wir die gegenwärtigen Probleme, weil wir an liberalen Prinzipien festhalten. Es klingt, als würden die Flüchtlinge nicht kommen, wenn wir für Menschenrechte keine Universalität beanspruchten. Es klingt, als könnte man Europas Wohlstand seiner Anziehungskraft berauben, indem man sich nur weniger liberal gibt.
Gerade aus der Perspektive eines politischen Realismus, der immerhin „Interessen“ (Morgenthau: Macht und Frieden, S. 51) für ausschlaggebend hält, sollte eigentlich nachvollziehbar sein, dass Lebenschancen immer anziehend wirken, ganz unabhängig davon mit welchen Grundwerten diese verbunden sind. Viele wenig erbauliche Dinge gibt es nur deshalb, weil Menschen damit ihren Lebensunterhalt bestreiten können oder sogar müssen oder sich davon Reichtum versprechen. So lange es Ungleichgewichte gibt, wird Wohlstand immer anziehend wirken.
Allein die Preisgabe des Liberalismus dürfte die materielle Anziehungskraft Europas deshalb nicht verringern, sie würde lediglich die Lebensqualität innerhalb Europas einschränken: Weniger Freizügigkeit, weniger Rechtsstaatlichkeit, weniger Freiheitsrechte und weniger Konsequenz bei den Menschenrechten würde die Europäer mancher Errungenschaft berauben, während sie einigen Flüchtlingen sogar entgegen käme. Autoritäre Regime gewohnt, sorgen hiesige Vielfalt und individuelle Freiheit doch gerade bei Migranten teilweise zu nicht unerheblichen Irritationen.
Folgte man Krastev, so sollen wir nun innerhalb Europas unsere liberale Lebenswelt aufgeben, weil wir nicht imstande sind, die ganze Menschheit daran teilhaben zu lassen. Wir sollen die Grundidee universeller Menschenrechte aufgeben, weil Europa nicht in der Lage ist, sie weltweit zu garantieren. Wir sollen von Rechtsstaatlichkeit absehen, weil wir sie nicht global zu etablieren vermögen. Wir sollen von Freizügigkeit innerhalb Europas absehen, weil wir keinen freien Zuzug ermöglichen.
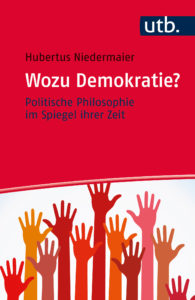
Nun ist die Idee des Liberalismus allerdings nicht von derjenigen der Selbstbestimmung zu trennen, wonach die Menschen selbst darüber bestimmen können sollen, wie sie zusammen leben wollen. In Demokratien wird genau das angestrebt. Man kann darüber streiten, inwiefern das in ihrer heutigen republikanischen Ausprägung der Fall ist, aber ihrem Anspruch nach zielt sie darauf (vgl. Niedermaier: Wozu Demokratie?).
Demokratische Länder haben ihren Liberalismus selbst gewählt und sie halten niemanden davon ab, ihnen nachzueifern. Nicht sie sind es, die genau das in anderen Ländern verhindern, sondern es sind diejenigen, die den europäischen Liberalismus verachten; es sind diejenigen, die als gelehrige Schüler des politischen Realismus der Macht folgen, statt der Bevölkerung Selbstbestimmung zuzugestehen.
Die Grenzen der Liberalität
Wenn Krastev den Liberalismus als widersprüchlich kritisiert, fokussiert er auf den Vorwurf, dass die EU Menschenrechte nur auf ihrem Territorium gewähre und den Zutritt dazu beschränke:
„Der Widerspruch zwischen dem universellen Charakter der Menschenrechte und ihrer Ausübung im nationalen Kontext bildet den Kern der aktuellen Krise der Linken angesichts des Flüchtlingsstroms.“ (S. 41)
Nun ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Rechte nur für das Territorium jener Staaten gelten, die sie gewähren. Immer wieder wurde es deshalb Staaten vorgeworfen, wenn sie die Menschenrechte nicht respektierten – und zwar von denjenigen Staaten, die ihrerseits davon überzeugt waren, dass sie es taten, was sie zudem als Ausweis ihrer Fortschrittlichkeit ansahen. Man hat die jeweilige Regierung dafür verantwortlich gemacht, dass nicht alle Menschen Grundrechte genießen. So lange es keine großen Flüchtlingsströme in Richtung dieser selbsternannten fortschrittlichen Länder gab, trug diese Logik.
Nun aber macht Krastev umgekehrt den liberalen Staaten den Vorwurf, dass sie es sind, die nicht die Menschenrechte respektieren – und zwar diejenigen, aller Menschen außerhalb ihres Territoriums. Die Logik dahinter lautet: Wenn Menschenrechte für alle gelten, aber nicht überall respektiert werden, muss es auch ein Recht geben, dorthin zu gehen, wo sie respektiert werden. So gewendet wird es streng genommen zu einem Argument dafür, Migranten weniger Steine in den Weg zu legen. Als Anhänger des politischen Realismus sieht Krastev jedoch genau darin eine Gefahr für Europa, was ihn zur umgekehrten Schlussfolgerung führt, den liberalen Anspruch auf unversale Gültigkeit der Menschenrechte infrage zu stellen.
Tatsächlich kann es kein konsequent liberales Argument gegen Migration geben, sondern dieses muss immer ein realpolitisches bleiben, sofern man unter Liberalismus die Garantie individueller Freiheiten versteht. So wenig unter dieser Maßgabe die Freizügigkeit innerhalb eines Territoriums eingeschränkt werden kann, so wenig kann man dies mit gleicher Argumentation auf globaler Ebene. Wer immer die Bewegungsfreiheit des Einzelnen einschränkt, kann nicht behaupten, dass dies im Dienste individueller Liberalität geschehe. Wer immer die Errichtung von Grenzen und Zäunen betreibt, tut dies aus einem realpolitischen Streben nach Abgrenzung, nach Erhalt der Machtverhältnisse.
Wer konsequent für individuelle Liberalität eintritt, muss sich für die Aufhebung aller Grenzen für die volle Freizügigkeit aller Menschen einsetzen. In diesem Punkt ist Krastev nicht zu widersprechen. Doch wer ungeingeschränkte Entfaltung für das Individuum fordert, könnte für die Abschaffung aller Regeln und Rechte eintreten. Das Verbot, Gewalt gegen andere auszuüben oder sie zu töten, schränkt die individuelle Entfaltung ebenfalls ein. Das Recht auf Eigentum entzieht allen anderen genau das, was ich besitze, und schränkt damit deren Freiheit ein, es in ihren Besitz zu nehmen. Das Recht auf Leben schränkt die freie Verfügung anderer über ihre Ressourcen ein, sofern sie dazu verpflichtet sind, Notleidende von ihren Mitteln zu unterstützen, um deren Überleben zu sichern. Ein konsequent am Individuum orientierter Liberalismus kennt nur ein Recht: Jeder kann tun und lassen, wonach ihm der Sinn steht, und niemand darf ihn dabei einschränken.
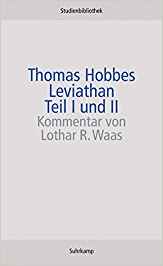
Der Grundsatz, dass meine Freiheit dort ende, wo die des anderen beginnt, folgt keinem liberalen Prinzip, sondern schränkt dieses ein, weil jeder radikal verfolgte Liberalismus zerstört, wonach er strebt. Uneingeschränkte individuelle Liberalität führt nicht zu Freiheit für alle, sondern zu Angst und Unterwerfung, denn wenn der individuellen Willkür keine Grenzen gesetzt werden, tritt der von Thomas Hobbes gefürchtete Zustand ein, „der Krieg eines jeden gegen jeden.“ (Hobbes: Leviathan, S. 96)
Der Schutz des Eigentums
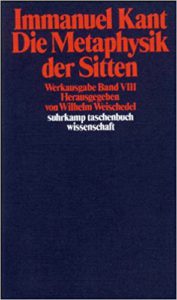
Wer nun diesen selbstmörderischen Liberalismus einschränken will, muss auf andere denn liberale Prinzipien zurückgreifen. Der Kantsche Grundsatz, wonach zu überlegen sei, was als allgemeines Gesetz gelten könne, hilft nicht weiter, weil grundsätzlich alles gelten könnte. (vgl. Kant: Die Metaphysik der Sitten, S. 337; B34) Man könnte Mord und Totschlag ebenso gelten lassen, wie man unter Hinweis auf Eigentum Hungernden Nahrung verweigern könnte. Der Liberalismus kennt keine Gesetze. Deshalb erscheinen die Ziele des politischen Liberalismus willkürlich: Auf welcher Grundlage kann man den Schutz des Eigentums anstreben oder den Schutz vor Ausbeutung verweigern? Auf welcher Grundlage kann man die Deckung der Grundbedürfnisse (auf Kosten des Eigentums anderer) zugestehen, aber ein Recht auf die Möglichkeit, aus eigener Arbeit sein Auskommen zu sichern, verweigern?
Der Liberalismus kennt dafür keine Prinzipien, sondern setzt die Regeln willkürlich. Im 19. Jahrhundert sah er das Elend der Ärmsten nicht nur als vertretbar, sondern im Gefolge von Thomas Malthus geradezu als sinnvoll an, im 20. gesteht er dagegen Wohlfahrt zu. Die einzige Konstante ist die Sicherung des Eigentums oder mehr sogar noch der Schutz der Wohlhabenden. Dahinter steckt keine liberale Logik, sondern eine realpolitische.
Es ist eben dieser realpolitische Anspruch auf Schutz des Eigentums, der auch die Grundlage für die Abschottung jeglichen Territoriums vor dem Zugriff anderer bildet. Das gilt für den eigenen Garten ebenso wie für ein Staatsgebiet.
Mehr noch als ein liberales ist das Dilemma, das Krastev anspricht, ein demokratisches. An den Grenzen der EU stößt das Prinzip individueller Selbstbestimmung auf das Prinzip kollektiver Selbstbestimmung. Im Zuge demokratischer Selbstbestimmung verweigern die EU-Staaten Einreisewilligen ihre individuelle Selbstbestimmung.
Es ist jene Demokratie, die Krastev für eine Gefahr ansieht, die jenen realpolitischen Maximen folgt, die er selbst hochhält: Die Verfolgung der eigenen Interessen und der Erhalt des Bestehenden. Was er betreibt ist eine babylonische Verwirrung der Begriffe.
Das ungelöste Problem ist und bleibt die Vermittlung von individueller und kollektiver Selbstbestimmung. Man mag bemängeln, dass Demokratie nationalstaatlich organisiert ist und, dass viele realpolitische Autokraten sie verhindern. Ob es angesichts des heutigen Selbstverständnisses aber eine Alternative zur Demokratie gibt, darf bezweifelt werden, zumal sich die Eliten nicht als bessere Wegweiser erwiesen haben. Zur Gefahr wurde Demokratie immer dann, wenn sie nicht global gedacht wurde, sondern in nationalstaatlicher Abgrenzung, wenn der Nachbar als Feind gesehen wurde. Genau das aber ist es, wohin ein politischer Realismus führt, wenn er stets blind aktuellen nationalstaatlichen Interessen folgt; und genau das ist, was die EU ihrem ursprünglichen Geiste nach verhindern sollte.
Eine Realist jedenfalls kann keine anderen Ziele anstreben außer stets nur nach Bestandserhaltung und Machterweiterung zu streben. Wo aber stünden wir als Menschen, wenn wir nie nach Höherem streben würden?
Mehr aus der Rubrik gegengelesen, unter anderem zu Ivan Krastev.
Literatur:
Thomas Hobbes: Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates; Frankfurt am Main 1966.
Immanuel Kant: Die Metaphysik der Sitten; Frankfurt am Main 1977.
Ivan Krastev: Europadämmerung. Ein Essay; Frankfurt am Main 2017.
Hans J. Morgenthau: Macht und Frieden. Grundlegung einer Theorie der internationalen Politik; Gütersloh 1963.
Hubertus Niedermaier: Wozu Demokratie? Politische Philosophie im Spiegel ihrer Zeit; Konstanz und München 2017.
Siehe auch:

Heribert Nix: Wozu Liberalismus? Struktur, Krise und Perspektiven liberaler Demokratie; UVK 2021.