– gegengelesen –
John Locke: „Über die Regierung“ (Teil 2)

Die erste seiner Zwei Abhandlungen über die Regierung widmet John Locke einer Widerlegung von Robert Filmer. Dieser hatte seine letzten Lebensjahre damit verbracht, mit Hilfe der Bibel zu begründen, weshalb dem Absolutismus Vorrang gebühre gegenüber jedwedem Parlamentarismus. Allerdings war Filmer bereits 36 Jahre tot, als Locke ihn so wortreich kritisiert. Angesichts dessen kann man sich die Frage stellen: Weshalb schreibt ein angesehener Philosoph so vernichtend, teilweise geradezu ehrenrührig über jemanden, der sich der Kritik nicht mehr aus eigener Kraft zu erwehren vermag?
Nun, eine letzte Schrift Filmers, die weite Verbreitung fand, erschien erst 1680 und damit über ein Viertel Jahrhundert nach dessen Tod. Angesichts der revolutionären Vorgänge in England, wollte Locke das so nicht stehen lassen. Er wollte denjenigen, auf den sich die Befürworter eines absolutistischen Königtums beriefen, vollständig widerlegen. Dabei stützt er sich allerdings nicht auf eine rationalistische Philosophie, wie sie seit René Descartes zur Verfügung stand und von Thomas Hobbes in die politische Theorie eingeführt wurde, sondern auf religiös begründete Grundsätze. Er versucht Filmer auf seinem eigenen Gebiet zu schlagen, zugleich offenbaren sich aber auch jene Grundlagen, welche Lockes politische Philosophie tragen, denn so wie sich die Passagen lesen, beruft sich er sich in seinen Argumenten auf den christlichen Gott:
„§42. Wir wissen aber, Gott hat keinen Menschen so der Gewalt eines anderen preisgegeben, daß dieser ihn nach Willkür verhungern lassen darf. Gott, der Herr und Vater aller, hat keinem seiner Kinder ein solches Eigentumsrecht an seinem besonderen Anteil der Dinge dieser Welt verliehen, sondern er hat seinem bedürftigen Bruder genausogut einen Anspruch aus dem Überschuß seiner Güter gegeben. Deshalb darf ihm dieser Anteil gerechterweise nicht verweigert werden, wenn Not und Bedürfnis es erfordern. Demnach könnte auch nie ein Mensch durch das Eigentumsrecht an Land oder sonstigen Besitz eine rechtmäßige Gewalt über das Leben eines andern haben; denn für einen besitzenden Mann wäre es stets eine Sünde, wenn er seinen Bruder durch mangelnde Unterstützung aus dem eigenen Überfluß umkommen läßt.“ (Locke 1977: S. 99)
Hier bleiben keine Zweifel am religiösen Fundament von Lockes politischer Philosophie. Gottes vermeintlicher Wille ist der Maßstab, an dem die Realität zu messen ist. Die christliche Lehre ist es demnach, die es verbietet, den Hungernden seinem Schicksal zu überlassen. Nicht gegen Filmer ist das gerichtet, vielmehr verleiht Locke seiner Überzeugung Ausdruck, wodurch Eigentumsrechten unhintergehbar Grenzen gesetzt sind. Auf Basis der Bibel erfolgt dann auch die Auseinandersetzung mit Filmer:
Die natürliche Herrschaft des Vaters! Aber was ist mit der Mutter?
„§74. Aber ich überlasse es dem aufmerksamen Leser unseres Autors, diese und viele andere Widersprüche, die er in Fülle bei ihm finden wird, miteinander in Einklang zu bringen. Ich will vielmehr untersuchen, wie sich diese beiden Grundpfeiler der Regierung, nämlich Adams natürliche und persönliche Herrschaft, verhalten und ob sie dazu in der Lage sind, die Rechtstitel der nachfolgenden Monarchen zu klären und zu beweisen. Denn unser Autor zwinge sie ja schließlich alle, ihre Macht von diesen beiden Quellen abzuleiten. Nehmen wir also einmal an, daß Adam durch die Schenkung Gottes zum Herrn und alleinigen Eigentümer der Welt eingesetzt wurde, und zwar mit so großem und weitreichenden Befugnissen, wie es sich Sir Robert nur wünschen kann. Wir wollen weiter annehmen, daß Adam durch das Recht der Vaterschaft absoluter Herrscher über seine Kinde war, mit einer unbeschränkten Oberhoheit. Dann frage ich mich folgendes: Was wurde nach Adams Tod aus seiner natürlichen und seiner persönlichen Herrschaft? Man wird mir zweifellos antworten, daß sie, wie unser Autor an verschiedenen Stellen sagt, auf seinen nächsten Erben übergingen. Es ist aber klar, daß auf diesem Wege unmöglich sowohl die natürliche wie auch die persönliche Herrschaft auf dieselbe Person übertragen werden kann. Selbst wenn wir zugeben, daß alles Eigentum, aller Besitz des Vaters auf den ältesten Sohn übergehen müßte (und für eine solche Regelung bedarf es noch des Beweises), und dieser somit den gesamten persönlichen Besitz des Vaters erhielte, so kann doch die natürliche Herrschaft des Vaters, die väterliche Gewalt, nicht durch Erbschaft auf ihn übergehen. Denn da dieses Recht einem Menschen nur aus der Zeugung erwächst, kann niemand diese natürliche Herrschaft über jemanden haben, den er nicht zeugte, falls man nicht etwa annehmen will, daß ein Mensch ein Recht auf etwas haben kann, ohne die Grundvoraussetzungen zu erfüllen, auf die dieses Recht allein begründet ist.“ (ebd. S. 126)
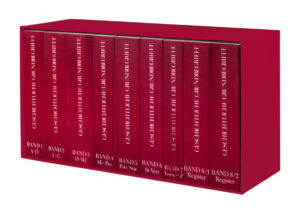
Locke legt dar, dass sich Königsherrschaft nicht auf Adam berufen kann, weil nicht die gleichen Voraussetzungen erfüllt sind. Nur ein Vater könne sich auf natürliche Herrschaft berufen, die sich aber nicht über den Kreis der eigenen Kinder hinaus erstrecke. Jeder Nachkomme, sei es Adams oder eines Königs, kann sich demnach lediglich auf persönliche Herrschaft berufen, die sich auf das Erbe des väterlichen Eigentums beschränkt. Filmers absolutistische Herrschaftsansprüche hält Locke damit für widerlegt, für einen Anhänger der Fürstenherrschaft ist es damit allerdings noch nicht, weil die Erbschaft von Eigentum dafür ausreicht. Wer das Land besitzt, kann auch über dessen Bewohner bestimmen, denn seine Nutzung bedarf der Zustimmung durch den Eigentumer. Für den Erben des Königs genügt es folglich, sich auf persönliche Herrschaft zu stützen (Koselleck/Moraw/u. a. 1982: S. 12f). Lockes Denken hatte sich von dieser mittelalterlichen Vorstellungswelt bereits entfernt, weil er Menschen ihrer Natur nach als frei und gleich ansah. Erbliche Herrschaft ist mit natürlicher Gleichheit aber nicht in Einklang zu bringen. Wie sollte es auch anders sein, wenn man es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Rechtmäßigkeit der Herrschaft William III. zu begründen, der immerhin James II., rechtmäßiger Erbe Charles II., vom Thron gestoßen hat.
Mag er Filmers Argumentation auch widersprüchlich nennen, so sind offenbar auch Lockes Schlussfolgerungen nicht über jeden Zweifel erhaben. Das gilt aus heutiger Sicht nicht nur für persönliche, sondern auch für natürliche Herrschaft. Erwirbt der Vater durch einen simplen Zeugungsakt tatsächlich Herrschaftsrechte über sein Kind? Wie ausgeprägt muss dann erst die natürliche Herrschaft der Mutter sein, da ihr Beitrag mit Schwangerschaft und Geburt doch jenen des Vaters weit übersteigt? Und wie verhalten sich dann beider Herrschaftsansprüche zueinander? Im 17. Jahrhundert konnte man sicherlich unwidersprochen dem Vater Vorrechte zugestehen und ebenso sicher ließen sich dazu passende Bibelstellen finden. Ein zeitlos sicheres Fundament für Herrschaftsansprüche ergibt sich aber weder aus der persönlichen noch aus der natürlichen Herrschaft. Dieses Ergebnis wiederum, teilt Locke voll und ganz; auch wenn seine Argumentation nicht rundweg zu überzeugen vermag, so geht es ihm doch genau darum: Denn ein dynastisches Recht auf den Thron, das schlicht auf Vererbung beruht, kann er nicht anerkennen, wenn er William als rechtmäßigen König ansehen will. Wer das Anrecht darauf hat, über andere zu herrschen, das müsse über andere Wege bestimmt werden:
§81. (…) Wenn ich auch noch so fest davon überzeugt bin, daß es Obrigkeit und Regierung in der Welt geben muß, so lebe ich nichtsdestoweniger so lange in Freiheit, bis sich herausstellt, welche Person das Recht auf meinen Gehorsam für sich beanspruchen kann. Denn wenn es keine Merkmale gibt, woran wir den rechtmäßig Herrschenden erkennen und von anderen unterscheiden können, kann ich es ebenso gut sein wie jeder andere. Unterwerfung gegenüber der Regierung ist die Pflicht eines jeden; da das aber nichts anderes bedeutet als eine Unterwerfung unter die Leitung und die Gesetze derjenigen Menschen, die Macht genug haben, sie zu verlangen, genügt es nicht einfach, einen Menschen zum Untertanen zu machen oder ihn davon zu überzeugen, daß es eine königliche Gewalt auf der Welt gibt, sondern es muß auch Wege geben, wie diese Person, die über diese königliche Gewalt rechtmäßig verfügt, bestimmt und erkannt werden soll. (ebd. S. 133)
Wie diese Wege aussehen, über die ein rechtmäßiger König bestimmt werden kann, das ist Gegenstand von Lockes zweiter Abhandlung.
Koselleck, Reinhart / Moraw, Peter / u. a. (1982): Herrschaft in: Brunner, Otto / Conze, Wernder / Koselleck, Reinhart: Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland. Band 3; Stuttgart.
Locke, John (1977): Zwei Abhandlungen über die Regierung; Frankfurt am Main.
Ein Gedanke zu „Natürliche Herrschaft“