– gegengelesen –
Thomas Hobbes: Leviathan (Teil 1)
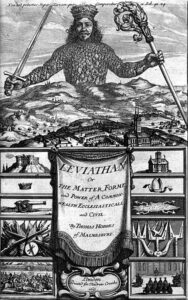
Im Jahr 1651 veröffentlicht Thomas Hobbes sein Buch über den Leviathan. Er hatte es während des Bürgerkriegs verfasst, der in England sieben Jahre lang tobte. Dieser prägte sein Denken, obwohl er ihn nicht leibhaftig erfuhr. Hobbes, der vor dem Krieg auf Seiten des Königs stand, war aus Angst vor politischer Verfolgung nach Frankreich geflohen. Dort verstand er die Vorteile zu nutzen, die Distanz für Analysen bereithält. Auch ohne das Grauen unmittelbar erlebt zu haben, warfen die Schrecken des Bürgerkriegs lange Schatten auf die menschliche Natur. Zumal zeitgleich vom Dreißigjährigen Krieg ebenfalls erschütternde Grausamkeiten berichtet wurden. Viele warfen Hobbes vor, ein düsteres Menschenbild zu vertreten. Doch angesichts des langjährigen Mordens erstaunt viel mehr der Optimismus, von dem der Leviathan getragen wird. Die Einleitung gibt einen Ausblick darauf, welch große Versprechen Hobbes einlösen wollte, schenkte man ihm Gehör.
Die Natur (das ist die Kunst, mit der Gott die Welt gemacht hat und lenkt) wird durch die Kunst des Menschen wie in vielen anderen Dingen so auch darin nachgeahmt, daß sie ein künstliches Tier herstellen kann. Denn da das Leben nur eine Bewegung der Glieder ist, die innerhalb eines besonders wichtigen Teils beginnt – warum sollten wir dann nicht sagen, alle Automaten (Maschinen, die sich selbst durch Federn und Räder bewegen, wie eine Uhr) hätten ein künstliches Leben? Denn was ist das Herz, wenn nicht eine Feder, was sind die Nerven, wenn nicht viele Stränge, und was die Gelenke, wenn nicht viele Räder, die den ganzen Körper so in Bewegung setzen, wie es vom Künstler beabsichtigt wurde? Die Kunst geht noch weiter, indem sie auch jenes vernünftige, hervorragendste Werk der Natur nachahmt, den Menschen. Denn durch Kunst wird jener große Leviathan geschaffen, genannt Gemeinwesen oder Staat, auf lateinisch civitas, der nichts anderes ist als ein künstlicher Mensch, wenn auch von größerer Gestalt und Stärke als der natürliche, zu dessen Schutz und Verteidigung er ersonnen wurde. Die Souveränität stellt darin eine künstliche Seele dar, die dem ganzen Körper Leben und Bewegung gibt, die Beamten und anderen Bediensteten der Jurisdiktion und Exekutive künstliche Gelenke, Belohnung und Strafe, die mit dem Sitz der Souveränität verknüpft sind und durch die jedes Gelenk und Glied zur Verrichtung seines Dienstes veranlaßt wird, sind die Nerven, die in dem natürlichen Körper die gleiche Aufgabe erfüllen. Wohlstand und Reichtum aller einzelnen Glieder stellen die Stärke dar, salus populi (die Sicherheit des Volkes) seine Aufgabe; die Ratgeber, die ihm alle Dinge vortragen, die er unbedingt wissen muß, sind das Gedächtnis, Billigkeit und Gesetze künstliche Vernunft und künstlicher Wille; Eintracht ist Gesundheit, Aufruhr Krankheit und Bürgerkrieg Tod. Endlich aber gleichen die Verträge und Übereinkommen, durch welche die Teile dieses politischen Körpers zuerst geschaffen, zusammengesetzt und vereint wurden, jenem ‚Fiat‘ oder ‚Laßt uns Menschen machen‘, das Gott bei der Schöpfung aussprach. (Hobbes 1966: S. 5)
Schon die erste Unterscheidung gibt die Richtung vor: Die Natur sei Gottes Werk, das Gemeinwesen aber künstlich. Damit wendet sich Hobbes gegen die Vorstellung, wonach der Gesellschaftsaufbau vorgegeben ist. Im Mittelalter konnte ein Herrscher nicht Schalten und Walten wie es ihm gefiel. Die soziale Ordnung stand nicht zur Disposition, musste doch auch sie Gottes Allmacht entsprungen sein, will man von ihrem Wirkungsbereich nichts ausnehmen. In aller irdischen Herrschaft schlug sich demnach der Wille Gottes niederschlagen. Bleiben uns dessen Gründe auch verborgen, so erlaubte uns eine solche Theologie, wie sie Augustinus formulierte, dennoch nicht, daran zu zweifeln. Der gesellschaftliche Aufbau muss demnach als gottgegeben hingenommen werden.
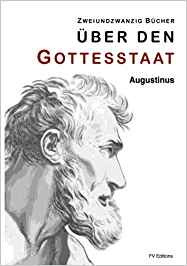
Und somit laßt uns die Gewalt, Herrschaft und Reich zu verleihen, allein dem wahren Gott zuschreiben, der die Glückseligkeit im Himmelreich nur den Guten verleiht, dagegen irdische Herrschaft sowohl Frommen als Gottlosen, wie es ihm gefällt, stets aber nach Recht und Billigkeit. Ich habe ja allerdings auf etwas hingewiesen, auf das eben, was Gott uns offenkundig sein lassen wollte; aber das Innere der Menschen zu durchschauen und in überzeugender Prüfung die Verdienste und Mißverdienste abzuwägen, die zur Verleihung von Herrschgewalt geführt haben, das ist zuviel für uns und übersteigt weit unsere Kräfte. (Augustinus: Zweiundzwanzig Bücher über den Gottesstaat. V.21)
Augustinus unterwirft alles Gottes Vorsehung. Hobbes dagegen zieht eine klare Grenze, zwischen dem Werk Gottes und jenem des Menschen. Er unterscheidet göttliche Natur und menschliche Kunst, ohne der Frage nachzugehen, ob es sich bei letzterer nicht um einen Teil der Vorsehung handele. Indem er dieses Problem ausklammert, eröffnet er weitreichende Perspektiven. Wer einen Sachverhalt seiner Schicksalhaftigkeit entreißt, hebt seine Unverfügbarkeit auf. Erachtet man das Gemeinwesen nicht als gottgegeben, erlangt der Mensch Zugriff. Das Zusammenleben wird zu einer Kunst und damit menschlicher Gestaltungskraft verfügbar. Das Zeitgeschehen dürfte daran seinen Anteil haben. Die Frage, ob der Mensch dem Schicksal ausgeliefert bleibt oder es in die eigenen Hände nehmen kann, gewann angesichts der schrecklichen Kriegserfahrungen sicherlich an Bedeutung. Wenn man konkret etwas tun konnte, um weitere Bürgerkriege zu verhindern, tritt dann nicht die theologische Frage in den Hintergrund, wie weitreichend der Schöpfer unser Schicksal bestimmt? Falls Gott in seiner Allmacht dem Menschen einen Handlungsspielraum zugestanden haben sollte, warum sollte man ihn nicht nutzen?
Für Hobbes ist das Gemeinwesen nicht Natur, sondern ein Kunstprodukt, ein Werk des Menschen, das dieser gestalten kann. Was heute selbstverständlich vorausgesetzt werden muss, weil Demokratie anders nicht denkbar ist, stellt für eine Monarchie eine Bedrohung dar. Sie verliert ihre Selbstverständlichkeit und gilt nicht länger als naturwüchsig. Das Herrschaftsmodell steht zur Disposition, die Menschen könnten sich auch ein anderes geben. Es entsteht Rechtfertigungsbedarf. Was anders sein könnte, braucht Gründe dafür, dass es so und nicht anders ist. Insofern überrascht nicht, dass Hobbes nach Veröffentlichung des Leviathan seine Anstellung als Mathematiklehrer des englischen Thronfolgers, der ebenfalls in Frankreich Zuflucht gesucht hatte, verlor.
Augustinus (2017): Zweinundzwanzig Bücher über den Staat. Bibliothek der Kirchenväter an der Universität Freiburg.
Hobbes, Thomas (1966): Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates; Frankfurt am Main.