– gegengelesen –
Niklas Luhmann: Soziale Systeme (Teil 3)

Wir alle hätten gern mehr davon: Zeit! Das galt sicherlich auch für Niklas Luhmann, obwohl er nicht mal genau angeben konnte, worum es sich dabei handelt. Damit allerdings ist er unter denjenigen, die sich mit dem Phänomen näher befasst haben, wahrlich nicht allein. Der kleinste gemeinsame Nenner ist wohl, dass Änderungen vonstatten gehen und es das ist, was wir als Zeit empfinden.
Jede realitätsbezogene Systemtheorie muß davon ausgehen, daß nicht alles so bleibt, wie es ist. Es gibt Änderungen, es gibt in Systemen Spezialsensibilisierung für Änderungen, und es gibt daher für einige Systeme Zeit im Sinn eines Aggregatbegriffs für alle Änderungen. Wir lassen offen, was Zeit „ist“, weil man bezweifeln kann, ob irgendein Begriff von Zeit, der über das bloße Faktum des Sichänderns hinausgreift, ohne Systemreferenz festgelegt werden kann. (Niklas Luhmann: Soziale Systeme, S. 70)
Die Dinge ändern sich und Systeme müssen irgendwie damit zurechtkommen. Sie können Sensibilität für Änderungen bestimmter Art entwickeln und damit ermöglichen, Reaktionen abzuleiten. Allerdings ist die Umwelt so komplex, dass nicht auf alle Änderungen reagiert werden kann, es kann noch nicht einmal alles erfasst werden. Menschen (streng genommen muss es freilich heißen: psychische Systeme) können zwar Farben, Geräusche, Gerüche, Geschmacksvarianten und Materialbeschaffenheiten wahrnehmen, nicht aber radioaktive Strahlung, elektromagnetische Felder oder Ultraschall. Andere Lebewesen müssen sich teilweise mit deutlich weniger Informationen über Änderungen in der Umwelt begnügen. So oder so bleibt es bei einem kleinen Ausschnitt dessen, was um einen herum geschieht. Und noch während man reagiert, finden weiterhin Veränderungen statt. Das System steht unter Zeitdruck.
Angesichts des Komplexitätsgefälles im Verhältnis zur Umwelt kann ein komplexes System sich, auch zeitlich gesehen, nicht nur auf Punkt-für-Punkt-Entsprechungen zur Umwelt stützen. Es muß auf vollständige Synchronisation mit der Umwelt verzichten und muß die damit gegebenen Risiken der momentanen Nichtentsprechung abfangen können. (ebd. S. 77)
Flexibilität durch Vergänglichkeit
Die Variabilität der Umwelt erfordert Flexibilität. Umso stabiler die Strukturen sind, die ein System aufbaut, desto schwerer fällt es, auf Veränderungen zu reagieren. Evolution setzt deshalb auf Vergänglichkeit. Sowohl auf der Ebene der Zellen als auch auf Ebene der Individuen hilft die Reproduktion bzw. der Generationenwechsel dabei, auf Veränderungen in der Umwelt zu reagieren. Umso länger die Spanne bis zur nächsten Generation, desto mehr hängt die Anpassung des Genpools gegenüber rapiden Entwicklungen zurück. Strukturen sind aber wichtig und sollten bei aller Vergänglichkeit erhalten bleiben, so lange sie sich bewähren. Es geht also darum, sie über den Generationenwechsel, über die Reproduktion hinweg zu erhalten, sie zu temporalisieren. Wie immer bei Luhmann: Was für Zellen gilt, gilt auch für Kommunikationen und Gedanken:
Temporalisierung der eigenen Komplexität ist Anpassung des Systems an die Irreversibilität der Zeit. Dadurch, daß das System die Zeitdauer der eigenen Elemente verringert oder gar auf bestandslose Ereignisse reduziert, kann es die Irreversibilität der Zeit mitmachen; es ist ihr nicht ausgeliefert, es kann sie copieren und läßt dann intern nur noch Strukturen zu, die in der Lage sind, entstehende und vergehende Elemente zu verknüpfen. (ebd. S. 77)
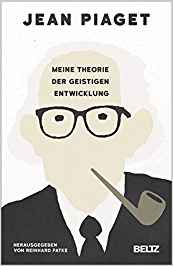
Das ist das faszinierende an Zellen, Individuen, Kommunikationen und Gedanken: Trotz Vergänglichkeit sind sie sowohl im Stande, Strukturen zu erhalten, als auch bei Bedarf zu modifizieren. Es kann allerdings nicht alles auf einmal geändert werden und es führt auch nicht jede Veränderung der Umwelt systemseitig zu einem Strukturwandel (mit Jean Piaget könnte man hier von Akkomodation und Assimilation sprechen, vgl. Jean Piaget: Meine Theorie der geistigen Entwicklung, S. 53ff). Systeme setzen stets auf bestehende Strukturen auf, um diese soweit nötig und möglich in einem fort zu transformieren.
Die eindrucksvollste Konsequenz dieser Theorie der Temporalisierung ist: daß sich eine neuartige Interdependenz von Auflösung und Reproduktion der Elemente ergibt. Systeme mit temporalisierter Komplexität sind auf ständigen Zerfall angewiesen. Die laufende Desintegration schafft gleichsam Platz und Bedarf für Nachfolgeelemente, sie ist die notwendige Mitursache der Reproduktion (Luhmann: Soziale Systeme, S. 78)
Man hat es hier mit einer dynamischen Stabilität zu tun, die durch andauernde Reproduktion aufrecht erhalten wird. Das System darf folglich nicht als statisch gedacht werden, sondern es setzt sich aus auftauchenden und untergehenden Elementen zusammen. Im System arbeitet es, fortwährend finden Operationen statt. Schlussendlich ist das System nichts anderes als ein Strom an Einzeloperationen, die im Zuge ihrer Reproduktion eben jene Struktur abwandeln, in der sie sich organisieren.
Reproduktion heißt also nicht einfach: Wiederholung der Produktion des Gleichen, sondern reflexive Produktion, Produktion von Produkten. Um deutlicher zu akzentuieren, daß nicht die unveränderte Erhaltung des Systems gemeint ist, sondern ein Vorgang auf der Ebene der Elemente, der für jede Erhaltung und Änderung des Systems unerläßlich ist, wollen wir die Reproduktion der ereignishaften Elemente als Operation bezeichnen. (ebd. S. 79)